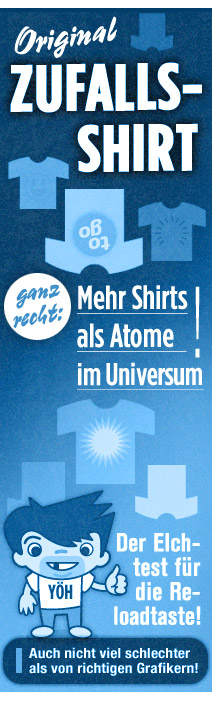20.01.2006 | 04:04 | Fakten und Figuren | Vermutungen über die Welt 
Sehen gar nicht so klein aus: Löcher (Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.)Wissenschaftler, diese Teufelskerle! Was verdanken wir Ihnen nicht alles! Teflon und Telefon, Klarlack und Fertigkuchen (russ. Zupf)! Ganz zu schweigen vom gesamten restlichen Zivilisationssurrounding. Das kommt unter anderem daher, dass der Wissenschaftler an sich, oft ohne es so recht zu ahnen, den Superlativ als Selbstzweck betrachtet. Er will das grösste X, das schnellste Y, auf jeden Fall aber mindestens das allererste Z erfinden, entdecken, entwickeln oder wenigstens publizieren. Dieser Trieb, man ahnt es bereits, schlägt ab und an für den Laien bizarre Blüten. So ist ja zum Beispiel unter Nichtwissenschaftlern weltweit anerkannt, dass das Nichts nichts ist, was so aufregend sein könnte. Jedenfalls, wenn es sich um das auf der Erde standardmässig vorhandene Amateur-Nichts handelt, also die Abwesenheit von allem ausser ein bisschen Luft. Das Nichts besteht aber eigentlich nicht nur aus dem Nichts selbst, sondern auch aus dem Etwas drumherum, ein Faktum, das mit einem kurzen Dialogklassiker ausreichend belegt sein dürfte: "Was hast Du?"- "Es ist nichts."
Eine der bekanntesten Formen um das Nichts herum ist mehr oder weniger rund, oft zylindrisch angelegt und heisst Loch. Wissenschaftlern aus Cardiff ist es nun gelungen, mit einer Elektrode das kleinste Loch der Welt zu bohren, das obere von den beiden auf dem Bild. Es hat einen Durchmesser von 0,022 Millimetern und ist damit ein Viertel so gross wie eine Haaresbreite. Das hört sich zunächst beeindruckend an, aber letztlich heisst es nicht mehr, als dass jemand das kleinste menschengebohrte Nichts in Lochform erschaffen hat. Toll!
18.01.2006 | 04:37 | Anderswo | Alles wird besser | Fakten und Figuren     In keinem anderen Land der Welt – China und vielleicht Japan jetzt mal ausgenommen – steht das Bildhauerwesen in höherem Ansehen als in Vietnam. In jeder Stadt des Landes stösst man auf mindesten einen Skulpturenpark, wo sich ausgefallen behauene Steine, Bronze- und Stahlplastiken bestaunen lassen. Grössere Städte wie Hue oder Hanoi verfügen über gleich mehrere dieser Skulpturengehege. Selbst die Umgebung der Ruinen von My Son, der Hauptstadt des versunkenen Königreichs von Champa (2.-13. Jhdt), hat man mit einem modernen Skulpturenpark aufgepeppt, weil den Vietnamesen offenbar die versammelten Weltkulturerbe-Trümmer irgendwie zu kaputt sind. In keinem anderen Land der Welt – China und vielleicht Japan jetzt mal ausgenommen – steht das Bildhauerwesen in höherem Ansehen als in Vietnam. In jeder Stadt des Landes stösst man auf mindesten einen Skulpturenpark, wo sich ausgefallen behauene Steine, Bronze- und Stahlplastiken bestaunen lassen. Grössere Städte wie Hue oder Hanoi verfügen über gleich mehrere dieser Skulpturengehege. Selbst die Umgebung der Ruinen von My Son, der Hauptstadt des versunkenen Königreichs von Champa (2.-13. Jhdt), hat man mit einem modernen Skulpturenpark aufgepeppt, weil den Vietnamesen offenbar die versammelten Weltkulturerbe-Trümmer irgendwie zu kaputt sind.
Die Bildhauer widmen sich dabei vorzugsweise der Darstellung von sekundären und primären Geschlechtsteilen, mal solo, mal im Duo und mal auch mit einem Menschenpaar drum herum in inniger Verschmelzung. So wird der herrliche Geschlechtsverkehr an sich gefeiert. Zugleich gerät symbolisch Phallisches (Mann mit dicker Panzerfaust) aus der Phase des sozialistischen Realismus mehr und mehr in den Hintergrund. Das ist natürlich gar nicht mal so unsympathisch.
Problematisch ist nur, dass sich die Skulpturenparks in rasantem Tempo vermehren, seit 1998 mit dem ersten internationalen Skulpturensymposion in Hue Modellierfestivals in Vietnam Mode wurden. Damals wurde auch der Skulpturen-Output noch einmal gewaltig gesteigert, weil man jetzt auch eine Vielzahl Ausländer dazu einlud, vietnamesische Steine zu zerkloppen.
Das letzte Symposion ist gerade erst am 25. Dezember in Chau Doc zu Ende gegangen, einem kleinen Weiler im Mekong-Delta, der direkt an der kambodschanischen Grenze liegt. Die Behörden der Provinz Ang Giang hatten den Event mit 5 Milliarden vietnamesischen Dong gefördert, und dann noch einmal 10 Milliarden (650.000 US$) in einen fünf Hektar grossen Park am Fusse des Sam Bergs gesteckt, wo die Skulpturen jetzt vor sich hin verwesen.
Der Riesenmaschinen-Korrespondent konnte leider nur im Vorbeifahren einen Blick auf das von Schlamm umspülte Skulpturenfeld werfen, wobei ihm ein rätselhaftes, besonders riesiges Trumm ins Auge fiel. Die Nachrecherche ergab: Es handelt sich dabei nicht um die erwartete Riesenmuschi oder einen Mega-Schwanz, es ist eine Reisschale und heisst "Rice Bowl & Chopsticks". Die Schüssel wiegt 30 Tonnen und wurde von der Französin Laury Dizengremel getöpfert, und zwar schon beim ersten Symposion in Chau Doc, das von November bis Dezember 2003 stattfand.
Frau Dizengremel, nach eigenem Bekunden "a professional award-winning sculptor, a mom, a wife and sometimes a poet", will aber mit "Reisschüssel und Essstäbchen" nicht etwa der hier zum Jahreswechsel erhobenen Forderung nach einer neuen Körperlust Nachdruck verleihen. Sie hat das Ding zur höheren Ehre des grossen amerikanischen Menschheitserlösers L. Ron Hubbard geschaffen, dessen Sinnspruch "Works of art... are the soul food of all people" mit Quellenangabe "Artist & Philosopher L. Ron Hubbard" auf Vietnamesisch und Englisch in den Trummzement eingraviert ist.
An der Seite der Schüssel, die man aus ganz bestimmten Gründen nur über diesen Link betrachten kann, ist zudem ein Gesicht appliziert. Frau Dizengremel meint, es stelle einen "imaginary" vietnamesischen Mann dar: "Well-fed, jolly, buddha-like". Tatsächlich trägt es aber sehr unvietnamesische Züge. Uns erinnert es eher an das Antlitz eines gut genährten, vergnügten buddhaähnlichen, amerikanischen Menschheitserlösers, vulgo L. Ron Hubbard, dem Begründer der "Church of Scientology". Warum sie es so mit diesem Mann hat, erzählt uns Frau Drizengremel dann auf dieser, irgendwie mit der Scientology-Kirche verbandelten Seite: Erst nachdem sie einige Scientology-Kurse absolviert und von dieser Seite spirituelle Beratung erhalten habe, habe sie zur aktiven Bildhauerei gefunden. Mag sein, dass ihre Schüssel auch deshalb an der Seite einen so grossen Sprung hat. Auf jeden Fall hat da eine das Thema eines vietnamesischen Skulpturenwettbewerbs nicht so ganz verstanden.
Besser kapiert haben es die japanische Steineklopferin Masami Aihara und ihr niederländischer Kollege Kees Buckens, die sich auf dem letztjährigen Symposion in Chau Doc zum allerersten Mal fi trafen. Am letzten Tag des Events gaben sie bekannt, dass sie demnächst gemeinsam in den Stand der Ehe einzutreten gedächten.
Dieser Beitrag ist ein Update zu: Asien Spezial: Korea & Vietnam
14.01.2006 | 18:02 | Fakten und Figuren 
(Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.)Es ist tragisch mitanzusehen, wie ein lustiger Bub wie Christoph Schlingensief so ganz ohne künstlerische Visionen versucht, irgendeine relevante Kunst zu machen, die wenigstens ein bisschen Innovation atmet. Aber es geht und geht nicht, heraus kommt immer das, was dem Hofnarren auch eingefallen wäre, wenn der König müde war, die üblichen "Provokationen" halt, ein paar Purzelbäume, Taschenspielertricks und eine ulkige Stimme. Schlingensief sieht, dass um Ihn herum alles schon getan, gesagt und ausprobiert wurde und wird. Und also kommt er – der tief in sich spürt, dass seine überbordende Gefallssucht verständlicherweise unbedingt verbergen muss, nur der Weissclown mit der verbogenen Klarinette zu sein – auf die Idee, all das zusammen zu packen, was schon getan, gesagt und ausprobiert wurde und daraus seinen eigenen Kunstbrei zu kneten.
Eine konsensuell kakophonische Mischung aus schlecht kopierten Elementen von Tobe Hooper, Helge Schneider, Rainer Werner Fassbinder, aus Unterschichtsfernsehen, Udo Lindenbergs Hippie-Freakshows mit Kleinwüchsigen, Werner Herzog, Joseph Beuys, Matthew Barney (siehe Foto), Wiener Aktionismus, sehr viel Paul McCarthy, Black Metal, Erlebnisgastronomie, André Hellers Luna Park, Dieter Roths Müllmanifeste, man weiss gar nicht, wo man anfangen und wo aufhören soll, alles muss absorbiert, annektiert, und wenn das nicht geht, dann als Gast zugekauft werden.
So wie für sein Spektakel "Area 7", das diese Woche am Wiener Burgtheater beginnt, den Maler Jonathan "Satansmerzbau" Meese, den vor Jahren vom Meisenfachmann Wolfgang Müller entdeckten Klaus Beyer und die unfassbar dumme, hässliche und bedeutungslose Brotspinne Patti Smith.
Und dieses Prinzip ist ganz praktisch, das Publikum, das doofe wie das so genannte intellektuelle, kann immer etwas erkennen, was es bereits schon mal irgendwo mitgenommen hat, muss sich also nicht aufregen, hier droht nicht DAS NEUE, DAS UNBEKANNTE, DAS UNHEIMLICHE, DAS HEHRE, DIE KUNST, hier droht allenfalls ein lärmender Kindergeburtstag, um 8 kommt dann der Clown Christoph mit den grossen quietschenden Schuhen.
14.01.2006 | 09:56 | Anderswo | Fakten und Figuren | Zeichen und Wunder  Vietnam ist der einzige Staat dieser Erde, in dem das gute alte Hammer und Sichel (H&S) Emblem noch an jeder Strassenecke präsent ist; im Gegensatz zu anderen, nominell noch kommunistischen Staaten. In China kommt das alte Logo praktisch nur mehr hinter Windschutzscheiben von Funktionärslimousinen vor; gewissermassen als Ausweis für freies Parken. Zudem war die Sichel im chinesischen Emblem schon immer etwas runder als beim sowjetischen Original. In Kuba sieht man statt des gekreuzten Werkzeugpaars praktisch nur Che entrückt dreinblicken, und in Nordkorea ist sowieso eine eigene Version in Umlauf: eine eher schlecht designte Kombi aus Hammer, Hacke und Pinsel, das offizielle Symbol der dortigen (Staats)Partei der Arbeit. Vietnam ist der einzige Staat dieser Erde, in dem das gute alte Hammer und Sichel (H&S) Emblem noch an jeder Strassenecke präsent ist; im Gegensatz zu anderen, nominell noch kommunistischen Staaten. In China kommt das alte Logo praktisch nur mehr hinter Windschutzscheiben von Funktionärslimousinen vor; gewissermassen als Ausweis für freies Parken. Zudem war die Sichel im chinesischen Emblem schon immer etwas runder als beim sowjetischen Original. In Kuba sieht man statt des gekreuzten Werkzeugpaars praktisch nur Che entrückt dreinblicken, und in Nordkorea ist sowieso eine eigene Version in Umlauf: eine eher schlecht designte Kombi aus Hammer, Hacke und Pinsel, das offizielle Symbol der dortigen (Staats)Partei der Arbeit.
Auch in Vietnam sind H&S das Emblem der Staatspartei, die hier auch noch ganz klassisch Kommunistische Partei Vietnams heisst. Im Strassenbild findet es sich fast ausschliesslich auf einer roten Fahne, die gerne auch neben der Nationalflagge (Grosser gelber Stern auf rotem Grund) hängt. Beide Fahnen, das kann auch der strengste Antikommunist nicht leugnen, sehen sehr, sehr gut aus, nicht nur, wenn sie im Sonnenlicht am malerischen Hoan Kiem See in Hanoi herumflattern. Es sind die prallen Farben, das schlichte Design und die sofort zu erfassende Symbolik, die sich jedem gleich in die Optik fräsen.
Stellt sich die Frage: Wer hat das H&S-Emblem eigentlich entworfen? Die Heraldiker und Vexillologen sagen uns: Keiner, bzw., wie sich das für eine kommunistische Bewegung gehört, praktisch alle. Erstmals aufgetaucht ist es im Zuge des russischen Bürgerkriegs, auf Fahnen revolutionärer armenischer Einheiten, etwa um 1917. Es hätte aber auch ganz anders kommen können. Wie auf einer kleinen Auswahl von Fahnen der frühen Roten Armee zu sehen ist, war das Vorläufersymbol ein Hammer und ein im Verhältnis dazu unproportionierter, klobiger, überhaupt schwer zu zeichnender und noch schwerer erkennbarer Pflug. Kaum denkbar, dass das internationale Unternehmen "Kommunismus" unter diesem katastrophalen Signet die bekannten Propagandaerfolge errungen hätte.
Anders als die Kommunisten liessen übrigens die Nazis ihren immensen Symbolbedarf von professionellen Designern decken. Das Emblem der SS, die verdoppelte germanische Sig-Rune, beispielsweise entwarf ein Walter Heck, der bei der Firma Ferdinand Hofstätter in Bonn beschäftigt war. Nun kann man auch diesem Logo unter streng designerischen Gesichtspunkten eine gewisse Dynamik nicht absprechen. Dafür war aber sein Schöpfer, im Nebenberuf noch SS-Sturmführer, ein echter Nazi-Blödmann. Heck, so steht es geschrieben, verkaufte seinen Entwurf irgendwann zwischen 1929 und 1933 für ganze 2 Mark fuffzig an die SS. Also exakt die Summe, die der ganze Nazi-Scheiss dann wohl auch wert war.
Dieser Beitrag ist ein Update zu: Asien Spezial: Korea & Vietnam
13.01.2006 | 17:03 | Supertiere | Fakten und Figuren | Vermutungen über die Welt 
Ehrenrettung eines Paarhufers (Foto: jamesjordan) (Lizenz) I am cow, eating grass // Methane gas comes out my ass // And out my muzzle when I belch // Oh, the ozone layer is thinner // From the outcome of my dinner // I am cow, I am cow, I've got gas
So unschön gehen die lustigen kanadischen Musiker Arrogant Worms dem armen Fleckvieh ans, ahem, Leder. Die Worms selbst sind vielleicht am berühmtesten für zwei brilliante Stücke, die sie weder geschrieben, noch je gesungen haben, nämlich The Toronto Song und The War of 1812 (obacht, beide Links gehen direkt auf eine mp3-Datei) von Three Dead Trolls in a Baggie. Aber genug von falsch zugeschriebenen lustigen Liedern von und für Kanadier, zurück zu Kuhfürzen.
Kuhfürze, das weiss ein jeder und schon lange, sind schuld am Treibhauseffekt und damit an unser aller Untergang. Pfui Teufel, Kuh, Du dumme Sau, möchte man vielleicht ausrufen, aber halt!
Jüngst erreichte uns nämlich in Form eines Nature-Aufsatzes die Nachricht, dass auch Urwälder furzen, und das nicht zu knapp. Die Autoren schätzen den Furzauswurf auf bis zu 236 Tg pro Jahr, was zwar nicht ganz ans theoretische Maximum von knapp 365.25 Tg/Jahr heranreicht, aber immerhin. Höchste Zeit also, die furzenden, insektenverpesteten Misthalden endlich niederzubrennen oder abzuholzen, und durch elegante Kuhweiden zu ersetzen. Müsste man vielleicht mal vorschlagen.
... 62 63 64 65 66 [67] 68 69 70 71 72 ...
|
 IN DER RIESENMASCHINE IN DER RIESENMASCHINE
 ORIENTIERUNG ORIENTIERUNG
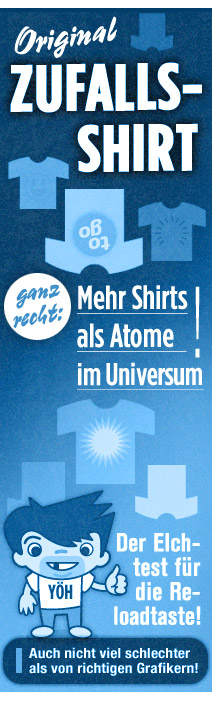


 SO GEHT'S: SO GEHT'S:
- mal rein hypothetisch
- Anrichten (Küchenschränke)
- Sequenzer
- Politessenladen
 SO NICHT: SO NICHT:
- Hirnhaut eincremen, also wirklich!
- Triebtäter ohne Trieb
- Verschlechterungen
- Anrichten (Schäden)
 AUTOMATISCHE KULTURKRITIK AUTOMATISCHE KULTURKRITIK
"Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans", Werner Herzog (2009)
Plus: 8, 15, 31, 42, 82, 97, 132, 136
Minus: 78
Gesamt: 7 Punkte
 KATEGORIEN KATEGORIEN
 ARCHIV ARCHIV
|
|