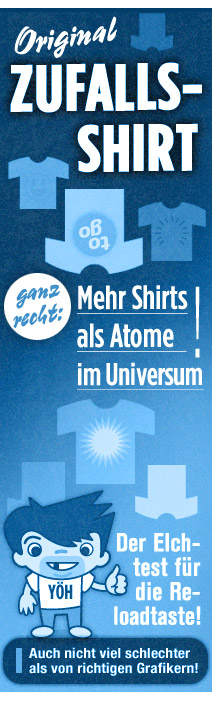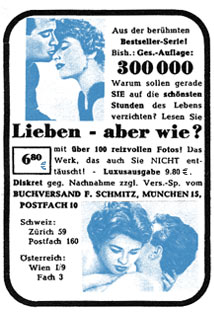29.07.2006 | 12:35 | Fakten und Figuren | Zeichen und Wunder 
(Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.)Zum Problem des Körpers, das die poststrukturalistisch inspirierte Geisteswissenschaft schlaflos hin und her wälzt (von Körpern von Gewicht bis hin zu Reizbaren Maschinen), gehört untrennbar auch das Problem der Haare. Die Körper bekommt die Disziplinar- oder meinetwegen Kontrollgesellschaft schon irgendwie in den Griff, spätestens bei den Haaren aber ist sie machtlos. Und auch der im Sinne der affirmativen Subversion positiv umcodierte Out-of-Bed-Look kann hier keine gesamtgesellschaftlich befriedigende Lösung sein. Was also tun mit den Haaren?
Mal die Kunst befragen: Simon Schubert füllt für die Saatchi Gallery eine Badewanne damit. Zuvor hat man dort die Putzfrau beiseite genommen und "gebrieft", damit nicht wieder das selbe passiert wie 1986 in Düsseldorf oder 2004 in London. Schon 1971 hatte bekanntermassen der Kopf- und Körperkünstler Timm Ulrichs einen "Künstlerhaarpinsel" aus Eigenhaar hergestellt. Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Sleek macht uns auf die holländische Künstlerin Chrystl Rijkeboer aufmerksam, die Haare zu ihrem Hauptwerkstoff erkoren hat. Und zwar strickt sie aus gesponnenem menschlichem Haar, das sie über Friseursalons bezieht, Pullis, Hasskappen und Ganzkörperumpuschelungen, bastelt aber auch andere haarige Objekte wie diesen Ohrenhaarsessel oder einen haarigen Ball mit Zähnen, der uns – wir wissen auch nicht genau, warum – an die Vagina Dentata denken liess. "Meine Arbeiten können auf zweifache Weise empfunden werden," sagt die Künstlerin, "entweder als gefällig, hübsch und unschuldig, oder als beunruhigend, abschreckend und schuldbeladen." Auch wir schwanken noch, und fühlen uns an eine Stelle aus Wolfgang Herrndorfs In Plüschgewittern erinnert:
Als Kind hatte ich mal die Idee, meine abgeschnittenen Fingernägel und überhaupt alles, was von meinem Körper abgemacht wurde, also Hornhaut, Schorf und Haare, in einem grossen Eimer unter meinem Bett zu sammeln und aufzubewahren. Ich dachte, dass es ein bedeutender Augenblick sein müsse, wenn das Gewicht dieser Dinge so gross würde, wie mein Eigengewicht. Dass ich wahrscheinlich sterben würde an diesem Tag.
Dass jetzt aber jemand die Probe aufs Exempel macht, auf die Idee kommt, ein derartige Objekt herzustellen und zur Kunst zu erklären – da sei die Kontrollgesellschaft vor.
27.07.2006 | 23:58 | Fakten und Figuren 
Am langsamsten jedoch vergeht die Zeit
beim Betrachten von Gürteltieren (Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.)Neben der gefühlten Temperatur gibt es natürlich auch eine gefühlte Zeit. Acht Stunden Fliessbandarbeit sind daher etwa zehn Stunden länger als acht Stunden Schlaf, wenn Raucher aufhören zu rauchen, vergeht für sie die Zeit bis zu 50% langsamer, und bindet man Freiwillige an ein Bungeeseil und wirft sie von einer Brücke, können sie plötzlich Zahlen von einem LED-Display an ihrem Handgelenk ablesen, die sonst nur Geflimmer wären. Rückwege hingegen erscheinen grundsätzlich kürzer als Hinwege. Das sollte man sich merken, denn es gibt im Alltag vielerlei nützliche Einsatzzwecke für solches Wissen: Wenn die Zeit knapp ist, schläft man am besten am Bungeeseil (vorher das Rauchen einstellen), Fliessbandarbeit sollte auf dem Rückweg erledigt werden.
Dieser Beitrag ist ein Update zu: Thementag: Das Vergehen der Zeit
27.07.2006 | 22:23 | Fakten und Figuren | Vermutungen über die Welt 
Zeit (objektiv) (Aus historischen Rechteklärungsgründen ist hier kein Bild. Aber im 20 Jahre Riesenmaschine-PDF gibt es entweder ein Bild oder eine Bildbeschreibung.) Wenn man Zeit und Philosophen zusammenführt, ergibt sich zumeist ein recht apartes Gemisch. Ein häufiges Reaktionsprodukt in solchen philosophischen Petri-Schalen ist die Behauptung, Zeit sei lediglich eine dem menschlichen Gemüte beiwohnende subjektive Vorstellung, ansonsten aber null und nichtig. Die Konsequenzen daraus werden aber selten gezogen. Als zum Beispiel John McTaggart die Irrealität der Zeit postulierte, warfen ihm seine Studenten zu Recht vor, im Widerstreit dazu dann doch an Prüfungsterminen festzuhalten.
Viel stringenter war da schon der Harvard-Professor Willard van Orman Quine. Für den Gottkaiser der modernen analytischen Philosophie sind die Weltendinge gemäss Relativitätstheorie nicht einfach in bestimmten Jetztpunkten existierende Entitäten, sondern vierdimensionale Raumzeitwürmer, die sich wurststückartig über ganze Raumzeitbereiche erstrecken. Insgesamt sind auch nicht nur alle Orte gleichberechtigt, sondern auch alle Zeitpunkte objektiv gleich real. D.h. aus unserer subjektiven Perspektive gesehen ist Raymond Burr tot, aber objektiv betrachtet lebt er noch. Quine folgert, dass man für eine der objekiven Realität gerechten Sprache alle Beugungen und Tempora in den Zeitwörtern streichen müsse. Sehr gut, sagen die Studenten, dann vereinfachen sich die Hausarbeiten. Eine weitere, zwingende Konsequenz aus seiner Theorie ist, dass es in der objektiv-zeitlich einförmigen Wirklichkeit keine Bewegung geben kann – wo kein Zeitfluss, dort keine Veränderung. Also hinfort mit allen Verben, hinfort mit Akkusativ und Dativ. Sprache jedenfalls ist für quineianische Studenten kein Problem mehr, die Graduierung erfolgt sofort. Nur blöd, dass Quine schon tot ist, bzw. vielleicht war das auch nur ein Trick.
Dieser Beitrag ist ein Update zu: Thementag: Das Vergehen der Zeit
27.07.2006 | 16:10 | Fakten und Figuren | Vermutungen über die Welt 
Schon 600 Mio. Jahre NichtstunBei allem Respekt für die vielfältigen Prozesse, mit denen das menschliche Gehirn den Zeitablauf manipulieren kann: Wesentlich geschickter stellt sich immer noch die Relativitätstheorie in dieser Angelegenheit an. Mit einem einfachen, vollkommen willkürlichen Handgriff erklärt sie die Geschwindigkeit des Lichts für konstant (man muss froh sein, es hätte auch die Geschwindigkeit des Postboten sein können), woraus sofort folgt, dass man nur in den Spiegel sehen muss, um sich selbst zu sehen, und zwar vor wenigen Nanosekunden. Ausgehend von dieser Tatsache bauen imaginative, wenn auch imaginierte Geister wie der irische Wissenschaftler de Selby komplexe Anlagen, die durch Mehrfachreflexionen und sukzessive Anhäufung von Lichtwegen letztlich Bilder des eigenen Kindergesichts zu erzeugen in der Lage sind. Und obwohl nicht klar ist, ob die Relativitätstheorie so einen Quatsch im Sinn hatte, als sie so früh am Morgen aufstand, beruht ihr Meisterstück, die intergalaktische Zeitreise, doch ganz genau auf demselben Prinzip: Der Stern am anderen Ende der Galaxie ist, wie jeder weiss, in unserem Bild 100.000 Jahre jünger als in echt. Das entspannte Theoriewerk erlaubt somit auch ganz ohne de Selby eine phantastische Reise zurück in eine exotische Zeit, als man noch keine Wasserspartasten auf WCs hatte. Was natürlich gar nichts heisst, denn in 100.000 Jahren macht so ein Durchschnittsstern, die faule Sau, fast genau gar nichts, also etwa so viel wie unser Gesicht in einigen Nanosekunden. Das muss auch mal klargestellt werden.
Dieser Beitrag ist ein Update zu: Thementag: Das Vergehen der Zeit
27.07.2006 | 04:22 | Fakten und Figuren | Vermutungen über die Welt 
Hält sich gern in der Nähe von Mäusen auf: BlätterteiggebäckMit allen anderen Sätzen dieses Beitrags verhält es sich übrigens genauso wie oben beschrieben. Dass wir den Lichtschalter betätigen, weil das Licht angegangen ist, glauben zumindest die Versuchspersonen in diesem Experiment, das die Frage "Kommt jetzt eigentlich vor oder nach jetzt?" abschliessend beantworten soll. Oder macht das Meer mit seinen Wellen, dass es windig wird? Erzeugen die Bäume mit ihren Blättern erst den Wind? Manchmal fragt man sich ja: Tritt man auf einen Zweig, weil er knackt? (Bei diesem scheinbar letzten Satz handelt es sich eigentlich um den ersten.)
Dieser Beitrag ist ein Update zu: Thementag: Das Vergehen der Zeit
... 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 ...
|
 IN DER RIESENMASCHINE IN DER RIESENMASCHINE
 ORIENTIERUNG ORIENTIERUNG
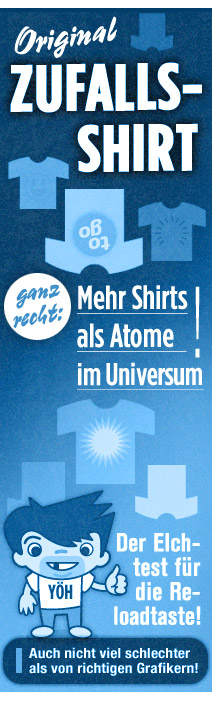
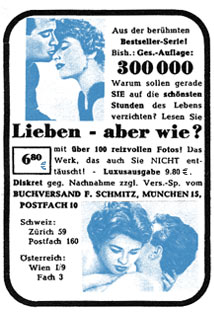

 SO GEHT'S: SO GEHT'S:
- Biermixgetränke (Astra/Asahi)
- bewusst aufschieben
- Kapuzenkonzeptskepsis
- Digibeau
 SO NICHT: SO NICHT:
- Umbra
- Hyperventilator
- Psychopompen
- Digibohne
 AUTOMATISCHE KULTURKRITIK AUTOMATISCHE KULTURKRITIK
"In Bruges", Martin McDonagh (2008)
Plus: 10, 12, 21, 24, 37, 46, 80, 104, 106, 119, 151 doppelt
Minus: 15, 57, 90, 170, 183, 185
Gesamt: 6 Punkte
 KATEGORIEN KATEGORIEN
 ARCHIV ARCHIV
|
|